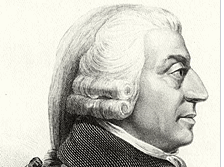
Wie verstehen wir die Theorien von Adam Smith?
Adam Smith wird von vielen in der Ökonomie und in der Politik für ihren eigenen Standpunkt vereinnahmt, am prominentestes für die „unsichtbare Hand des Marktes“, den die neoliberale Ökonomie predigt. Solche Interpretation übersehen zur Gänze das Menschenbild bei Smith, das mit der gängigen Vorstellung eines Homo Oeconomicus nicht vereinbar ist. Zum Menschsein gehört für Smith ganz grundsätzlich die Fähighkeit zur Imagination.
(Geänderter) Auszug aus dem Aufsatz Narration und Imagination. Die Rolle von imaginierten Bildern in der Geschichte der Wirtschaftstheorie, der Ende 2020 erscheinen soll in: Priddat, Birger / Künzel, Christine (Hg): Fiktion, Narration in der Ökonomie. Interdisziplinäre Perspektiven auf den Umgang mit ungewisser Zukunft
Imagination und Moral
Bei Adam Smith nehmen mentale Bilder einen derart großen Stellenwert ein, dass er als Bildanthropologe bezeichnet werden kann. Smith startet seinen ersten Bestseller, die Theory of moral sentiments, mit der anthropologischen Behauptung, es gäbe „Prinzipien der menschlichen Natur“, die für die Menschen aller Zeiten und aller Kulturen Geltung besutzen. Smith spricht von „natürlichen“ Eigenschaften, das sind die passions. Dazu zählt er auch die Neigung, am Schicksal anderer derart Anteil zu nehmen, dass die Gefühle anderer mit- und nachvollzogen werden:
„That we often derive sorrow from the sorrow of others, is a matter of fact too obvious to require any instances to prove it.“ (Smith 1976, 9).
Diese Fähigkeit der menschlichen Species entstammt nicht aus sinnlichen Beobachtungen alleine und auch nicht direkt aus der Vernunft, sondern aus einem spezifischen Vorstellungsvermögen:
“By the imagination we place ourselves in his situation, we conceive ourselves enduring all the same torments, we enter as it were into his body, and become in some measure the same person with him, and thence form some idea of his sensations, and even feel something which, though weaker in degree, is not altogether unlike them.“ (ebd.)
Mit imagination meint Smith die Fähigkeit des Menschen innere Bilder zu entwerfen („to picture out in our imagination“, ebd., 18) und sich reflexiv darauf zu beziehen. In der Interaktion mit anderen vollziehen Menschen andauernd die Gefühlszustände anderer Personen nach. Dadurch entstehen fellow-feelings (ebd., 10) bzw. der Zustand von sympathy, in welchem die sensations anderer in einer abgeschwächten Weise (mit)erlebt werden – Griswold (2006) und Brady (2011) sprechen von „sympathetischer Imagination“. Diese Fähigkeit stellt nach Smith eine aktive Kraft dar und bewirkt eine Integration der Individuen in ein soziales Feld. Sie fungiert nicht nur emotional, sondern besitzt auch kognitive Komponenten und entwirft Geschichten in Einklang mit Bildern und Simulationen:
„The sympathetic imagination is not solely representational or reproductive. It is primarily narrative, seeking to flow into and fill up another situation, and to draw things together into a coherent story, thus bringing the spectator out of him- or herself and onto the larger stage.” (Griswold 2006, 26)
Moral entsteht nach Smith aus dem wechselseitigen Bezug von imaginations, die jede Person andauernd mit allen anderen entwirft, denen sie real begegnet oder die sie sich mental vorstellt. In diesem Prozess beeinflussen sich Menschen gegenseitig, und zwar die ganze Zeit. Dabei werden ihre prämoralischen passions, die auch selbstbezogen sein können, in einen Sozialraum bzw. in einen sozialen Kontext gestellt. Dies hat zur Folge, Menschen gleichsam in moralische Wesen zu verwandeln. Smith beschreibt diese Vorgänge in einem reichhaltigen Modell mit mehreren vorgestellten Positionen, aus denen unterschiedliche Arten von assoziativen und dissoziativen „Bildern“ entspringen (als Einführung vgl. Ötsch 2016). Je mehr Menschen diese Fähigkeiten schulen, umso „interpersoneller“ (im Sinn von gesellschaftlich „objektiver“) kann ihre Bewertungspraxis werden. Schließlich richten dies nicht nur auf andere, sondern auf sich selbst: Sie bewerten (bzw. „sehen“) sich selbst aus einer neutralen Außenposition. Dieser schrittweise erlernte Vorgang kulminiert in der Bildung einer inneren Instanz, die Smith impartial spectator nennt (ebd., 17f.). Man kann sie als sozialisiertes Gewissen deuten – mit Bezügen zur christlichen Moral, zu einem christlichen Gott sowie zum Gewissensbegriff in der Stoa (vgl. z.B. Smith 1976, 58ff.). Wenn alle Menschen diese Prozesse andauernd unternehmen (müssen), dann entsteht nach Smith wie von selbst ein dichter sozialer Raum. Die Gesellschaft ruht auf imaginativen Vorgänge und muss imaginativ immer wieder rekonstituiert und wechselseitig adjustiert werden.
Imagination bei Hume
Smith hat keine eigene Theorie der Imagination hinterlassen, er rekurriert hier auf die Philosophie seines Freundes David Hume (vgl. Force 2003 und Griswold 2006). Bei Hume nehmen Imaginationen bekanntlich eine prominente Rolle ein (vgl. Wilbanks 1968 und Collier 2010). Hume postuliert die Existenz einzelner Ideen im menschlichen Geist. Sie werden als images interpretiert und beziehen sich auf impressions oder auf andere Ideen. Impressionen und Ideen unterscheiden sich für Hume nicht hinsichtlich ihrer „Natur“, sondern nur hinsichtlich ihrer „graduellen Erlebnisintensität“ (vgl. Hume 1960, 1ff., 6 und 9).. Ein Objekt aktuell sinnlich wahrzunehmen oder sich gedanklich vorzustellen macht für Hume keinen qualitativen Unterschied aus.
In diesem Konzept muss die behauptete Ordnung der Welt letztlich eine imaginative Basis besitzen. Alle diesbezüglichen Grundbegriffe bei Hume, wie Ähnlichkeit, Kontiguität oder Kausalität, besitzen imaginative Aspekte, z.B. auch:
„The idea of a substance as well as that of a mode, is nothing but a collection of simple ideas, that are united by the imagination.“ (ebd., 15f.)
Und:
„identity […] is […] a quality, which we attribute to [different perceptions], because of the union of their ideas in the imagination, when we reflect upon them.“ (ebd., 260)
Hume unternimmt in seiner Theorie eine erkenntnistheoretische Balance. Auf der einen Seite lehnt er die Vorstellung gegebener Substanzen ab, insbesondere jene von Geist und Materie. Denn die Basis des Erkennens können nur sinnliche „Eindrücke“ sein, auf denen sich als Abbilder von Eindrücken (imaginative) Vorstellungen bilden. Auf der anderen Seite teilt er die „Commonsense-Unterstellung einer vom Bewusstsein unabhängig existierenden Welt, über deren an sich seiende Beschaffenheit wir allerdings nur spekulieren können“ (Habermas 2019, 1081). Insbesondere rekurriert er aber (auch hier folgt ihm Smith) auf die Vorgangsweise von Newton:
„Für Hume ist aber, und das ist für alles weitere entscheidend, Newtons Physik nicht nur Beispiel für das Explanandum, sondern zugleich Vorbild für das Explanans selbst: Hume richtet die Psychologie der Erkenntnis, die die subjektiven Bedingungen der möglichen Erkenntnis kausaler Beziehungen – und des Sinns von Kausalität selbst – erklären soll, ihrerseits nach dem Vorbild der modernen Erfahrungswissenschaften aus.“ (ebd.)
Gesellschaftsbilder bei Smith
Der Verweis auf Hume kann für ein Verständnis von Smith hilfreich sein (und auch Hinweise dafür geben, wie verkürzt und fehlerhafte gängige Deutungen von Smith z.B. in den Lehrbüchern der Mikroökonomie immer noch sind). Wie Hume definiert Smith wichtige Begriffe als imaginativ und vermeidet zugleich eine antirealistische Position. Das zeigt sich auch an zwei Begriffen, die für sein Gesamtkonzept eine große Rolle spielen, die Gesellschaft und das Selbst bzw. Bilder von der Gesellschaft und dem Selbst (dem Selbstbild). Gesellschaft formt sich nach Smith, wie schon erwähnt, in einem Netz von Fremd- und Selbstbewertungen, in dem sich Selbst-Bilder und Handlungen verändern und aneinander anpassen. Ihre Gesamtheit bildet ein System, das ‒ Newton folgend ‒ in der Analogie zu einer Maschine beschrieben wird:
„Human society, when we contemplate it in a certain abstract and philosophical light, appears like a great, an immense machine, whose regular and harmonious movements produce a thousand agreeable effects.“ (Smith 1976, 288)
Bei Smith gibt es genaugenommen kein einzelnes Selbstbild (in der Bedeutung, dass ein einziges imaginiertes Bild mit einem „Ich“ verbunden bzw. von einem Individuum als selbstzugehörig erachtet wird), sondern mehrere. Sie sind mit den verschiedenen „Positionen“ in der Bildung einer moralischen Persönlichkeit bzw. der Formung eines impartial spectators verbunden. Ein Teilbereich sind zwei Ich-Positionen im Wechselspiel:
„When I endeavour to examine my own conduct, when I endeavour to pass sentence upon it, and either to approve or condemn it, it is evident that, in all such cases, I divide myself, as it were, into two persons; and that I, the examiner and judge, represent a different character from that other I, the person whose conduct is examined into and judged of. The first is the spectator, whose sentiments with regard to my own conduct I endeavour to enter into, by placing myself in his situation, and by considering how it would appear to me, when seen from that particular point of view. The second is the agent, the person whom I properly call myself, and of whose conduct, under the character of a spectator, I was endeavouring to form some opinion. The first is the judge; the second the person judged of. But that the judge should, in every respect, be the same with the person judged of, is as impossible, as that the cause should, in every respect, be the same with the effect.“ (Smith 1976, 113).
Gleichzeitig intendiert Smith, wenn er Handlungen beschreiben will, eine hierarchische Beziehung zwischen den beiden „Ichs“, zeitweise können auch Widersprüche und Zwiespälte auftreten (ebd., 148). In einer normativen Wende seiner prinzipiell deskriptiven Theorie5 postuliert er für den „,man of real constancy and firmness, the wise and just man“, dieser solle sich mit dem spectator identifizieren:
„He does not merely affect the sentiments of the impartial spectator. He really adopts them. He almost identifies himself with, he almost becomes himself that impartial spectator, and scarce even feels but as that great arbiter of his conduct directs him to feel.“ (ebd., 147)Charles Griswold fasst diese Sichtweise so zusammen:
„Smith proposes an impartial spectator, not an impartial actor, account of moral judgment. Sentiments are moral or virtuous when approved by the impartial spectator, and therefore the ‚theory of moral sentiments’ is a theory of the spectator’s approval of the emotions.“ (Griswold 1999, 104)
Smith kann damit keine positivistische Handlungstheorie nach Art der Neoklassik zugeschrieben werden. Denn das Handeln von Menschen beruht mach ihm auf imaginativen Bewertungspraktiken, die sie Kraft ihrer „natürlichen“ Anlagen permanent unternehmen. Handeln basiert auf moralischen Standards – unterstützt, aber nicht geleitet von der Vernunft (z.B. Smith 1976, 320ff.). Smith betrachtet zudem die Vernunft nicht als instrumentell, im Dienste z.B. der Bedürfnisse, wie das die Neoklassik behauptet. In seinem komplexen Modell kann Smith den Individuen keine eindeutige Ichbezogenheit (bzw. keinen Egoismus) zuordnen, es geht auch nicht ausschließlich um individuelle und private Angelegenheiten.6 Denn eine solche Orientierung wäre für Smith letztlich nur aus einer einzigen Position möglich, die das Individuum beziehen müsste, z.B. wenn sie wie in der Neoklassik ein gegebenes Set von „Bedürfnissen“ besitzt. (In einem Präferenzansatz besteht ein Rätsel dann darin, von wo und wie die Individuen ihre Präferenzen erlangt haben sollen).
Smiths konzipiert das Selbst (bzw. die diversen Selbst-Positionen) immer als aufeinander bezogen und reflexiv. Menschen sind nicht gedankenlos einer Situation ausgesetzt (was ein situationslogischer Ansatz unterstellt), sondern sind in der Lage eine Situation („within the breast“) aus unterschiedlichen Sichtweisen wahrzunehmen und differenziert zu bewerten.7 Menschliches Selbstbewusstsein basiert nach Smith auf Imaginationen, die andere Personen miteinbeziehen und sich auf andere beziehen. Der impartial speculator ist gleichsam die Summe aller anderen „Bewusstseine“ in der Gesellschaft: andere Menschen stellen den „Spiegel“ dar, den ein Selbst (ein Selbst-Bild) zu seiner Existenz benötigt.8 Der Fokus liegt auf der Gesellschaft und auf prozessoralen Abläufen, nicht auf einem isolierten Ich in statischen und isoliert vorliegenden Entscheidungskonstellationen.
Smith wendet seine Sichtweise prinzipiell auf alle sozialpsychologischen Phänomene an. Folgerichtig muss er sich selbst, auch in seiner Rolle (bzw. in seiner „Identität“) als Wissenschaftler als Person mit Imaginationsvermögen verstehen. Wissenschaft als menschlicher Prozess ist das Werk der Imagination:
„Philosophy […], may be regarded as one of those arts which address themselves to the imagination; and whose theory and history, upon that account, fall properly within the circumference of our subject.“9
Wissenschaft basiert auf sentiments, wie „Wonder, Surprise, and Admirations“, so beginnt Smith seine posthum publizierte History of Astronomy (Smith 1982, 33), in der er sein Konzept derentwirft (der volle Titel lautet The Principles which lead and direct Philosophical Enquiries: illustrated by the History of Astronomy). Wissenschaftler wollen nach Smith Unerklärbares (“disjointed objects”) in eine neue Ordnung bringen. Dieser Versuch stimuliert Imaginationen, die letztlich (wenn sie so gelingen wie bei Newton, ebd., 104) zu einer imaginativen Erklärungskette bzw. einem kohärenteren „theatre of nature“ führen „and therefore a more magnificent spectacle, than otherwise it would have appeared to be“ (ebd., 46). Ein wissenschaftliches Modell ist nicht nur ein formales Abbild, sondern genügt auch ästhetischen Kriterien, Wissenschaft dient nicht primär der Erringung von Macht, wie ursprünglich bei Francis Bacon.
Aber wissenschaftliche Imagination ist für Smith keine reine Fiktion, sie muss besonderen Ansprüchen genügen. Dazu muss sie auch durch eine geeignete methodische Heuristik kontrolliert werden. Das Vorbild ist die Vorgangsweise, die Newton praktiziert hat, sie gilt auch für die Sozialwissenschaften, die damals noch moral sciences heißen:10 Dabei soll der Untersuchungsbereich zuerst auf die einfachsten Phänomene reduziert werden (in der Philosophiae Naturalis Principia Mathematica beginnt Newton mit der idealisierten Situation eines Massepunktes in Bewegung). In dieser idealen Ausgangssituation sollen die „essentiellen“ Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes klar zum Vorschein kommen (die essentielle Eigenschaft der Materie ist bei Newton bekanntlich die Trägheit, vis inertiae). In Analogie dazu postuliert Smith „natürliche“ Eigenschaften bei den Individuen (die passions). Sie fungieren wie „Kräfte“, die wie bei Newton im untersuchtem Feld selbst liegen und zu einem Zustand eines Gleichgewichts streben (vgl. dazu Black 1963, Campbell 1971, Clark 1992, Freudenthal 1982 und Berry 2006). Ziel der Wissenschaft ist die Formulierung eines Systems:
„A system is an imaginary machine invented to connect together in the fancy those different movements and effects which are already in realty performed.“ (Smith 1982, 66).