Vorwort zur 2. Auflage von Mythos Markt 2025
Der Neoliberalismus hat alle Krisen des 21. Jahrhunderts unbeschadet überstanden. Er ist dadurch nicht schwächer, sondern stärker geworden. Jetzt geht er eine Synthese mit einem radikalisierten Konservatismus und einem militanten Rechtsradikalismus ein. Überall in der reichen westlichen Welt sind diese Strömungen auf dem Vormarsch. Sie bergen das Potenzial, die liberale Demokratie zu zerstören und eine Lösung der ökologischen Krisen vollends unmöglich zu machen.
Die schrittweise Hinwendung des Neoliberalismus zum Rechtsradikalismus wirft viele Fragen auf. Wie konnte sich aus dem Liberalismus, der als Wegbereiter der modernen Demokratie gilt, eine neue Version entwickeln (der Neoliberalismus), der sich schließlich als Totengräber der liberalen Demokratie entpuppt? Welche Verschiebungen im Denken haben stattgefunden, dass eine Synthese mit den Feinden der Demokratie möglich wurde?
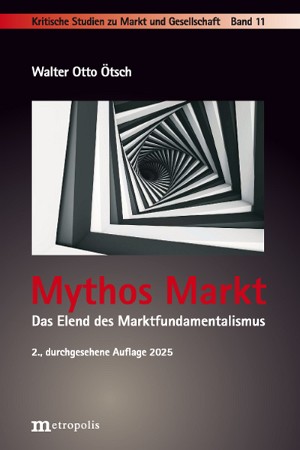
In diesem Buch will ich im letzten Kapitel eine Antwort auf der Ebene des Denkens geben, indem ich auf eine Gemeinsamkeit in der neoliberalen und der rechtsradikalen Begriffsbildung aufmerksam mache. Dazu lade ich Sie ein, sich zuerst in das neoliberale Denken zu vertiefen. Es wird hier auf einen Grundbegriff zurückgeführt, den Begriff „des Marktes“ in der Einzahl. Dieser Begriff wird in diesem Buch anhand seiner Begründer im Detail erklärt.
Mein Ansatz: den Neoliberalismus vom Begriff „der Markt“ her zu erfassen, ich spreche von Marktfundamentalismus. Denn dem Ausdruck „der Markt“ kommt eine grundlegende Bedeutung zum Verständnis vieler Trends zu:
- „Der Markt“ stellt den zentralen „Kollektivgedanken“ im neoliberalen „Denkkollektiv“ dar, auf den sich alle beziehen, die sich selbst als neoliberal bezeichnen oder bezeichnet haben (siehe S. 155f. und 431f.). Dieser gemeinsame Gedanke findet sich in unterschiedlichen Wirtschaftstheorien, die sich auf der Ebene von Paradigmen (die herkömmliche Art, wissenschaftliche Ansätze zu unterscheiden) deutlich voneinander abheben. Ein Kollektivgedanke liegt schließlich unterhalb der Ebene von Paradigmen. Diese Grundlage macht verständlich, warum Vertreter:innen vieler Theorien trotz ihrer Unter- schiede in Netzwerken und Thinktanks zusammenarbeiten, um wissenschaftlich und gesellschaftspolitisch gemeinsame Wirkung zu entfalten (Ötsch u.a. 2017). Der Erfolg des Neoliberalismus beruht auch auf dieser Zusammenarbeit.
- Der Kollektivgedanke „des Marktes“ war in mehreren einander überschneidenden Wellen wirkungsvoll, zuerst in der Wissenschaft, vor allem in den Wirtschaftswissenschaften, dann ab den 1970er- und 1980er-Jahren in der Politik (S. 145ff.). Die Folge war eine veränderte Art Politik zu machen, auch unter dem Einfluss marktfundamentaler Think-Tanks (S. 145ff., 501ff.). Politiker:innen fühlten sich nicht mehr zuständig, die Gesellschaft zu gestalten (S. 95) und gaben keine gesamtgesellschaftlichen Ziele jenseits „des Marktes“ vor (S. 45, 144, 236, 423). (In diese Lücke stürzen sich später die Rechtskonservativen und -radikalen, die einen Kulturkampf starten und die Gesellschaft nach ihrem fiktiven Bild „des Volkes“ verändern wollen, S. 546ff.).
- Spätestens ab den 1990er-Jahren verändert die Leitfigur „des Marktes“ das Wirtschaftssystem weltweit. Es entsteht ein neuer globaler Finanzkapitalismus (Slobodian 2018), bei dem die Dynamik von Finanzsektoren ausgeht, denen die „Freiheit“ gewährt wurde, sich ungehindert zu entwickeln. Das führte direkt zur Finanzkrise 2008.
- Der größte Erfolg des Konzeptes von „dem Markt“ liegt aber auf der Ebene der Gesellschaft, die als ökonomisierte Gesellschaft (S. 452ff.) verstanden werden kann. Eine ökonomisierte Gesellschaft hat die Denkfigur „des Marktes“ verinnerlicht (S. 13), viele Bereiche und Institutionen wurden nach Regeln „des Marktes“ umorganisiert. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Prozess so verdichtet, dass weithin aufgehört wurde, Wirtschaft und Gesellschaft als neoliberal zu bezeichnen (Mirowski 2014). „Der Markt“ ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die mit Schweigen übergangen wird. Er stellt einen Rahmen für das Denken und Handeln dar, über den wenig reflektiert wird – und der genau in dieser Nichtreflexion handlungs- wirksam werden kann. Das gilt vor allem für viele Ökonom:innen. Sie betreiben mit zahlreichen Verbündeten ein Projekt, das sie in ihrer Stoßrichtung und in ihrem Ausmaß nicht erkennen (S. 480ff.). Ein Beispiel liegt in der Ausbildung der Ökonomie selbst. Das Hauptmodell, das fast überall unterrichtet wird (die neoklassische Gleichgewichtstheorie) wird meist marktfundamental vermittelt, d.h. ohne dies den Studierenden erkenntlich zu machen (S. 165ff.).
- Der umfassende gesellschaftliche Erfolg des Marktfundamentalismus wurde auch dadurch möglich, dass „der Markt“ als eine Totalität definiert ist, die die früher getrennten Bereiche von „Gesellschaft“ und „Wirtschaft“ zu einem homogenen Feld zusammen-denkt. Dies leistet der Begriff „Ordnung“ bzw. „die Ordnung des Marktes“ (S. 29, 47, 85): eine Totalität, die keine gesellschaftlichen und sozialen Grenzen kennt und deshalb immer weitere Teile der Gesellschaft erobern konnte. „Der Markt“ ist zur theoretischen Waffe zur Umgestaltung der Gesellschaft geworden.
- Diese Wirkung kommt auch durch den dualen bzw. binären Code (S. 35ff., 427ff. und 476ff.) zustande, der dem Begriff „Markt“ notwendig anhaftet. Hier wird „dem Markt“ ein logisches Gegenteil, „der Nicht-Markt“, gegenüberstellt, z.B. „der Staat“ als Gegenspieler „des Marktes“. „Markt“ und „Nicht-Markt“ bedingen einander (S. 29ff.). Die Dualität normiert den Diskurs über soziale Phänomene in einer entscheidenden Weise. Man kann über sie zugleich beschreibend und normierend sprechen. Das vordergründig wissenschaftliche Reden von „dem Markt“ kann übergangslos in einen Moraldiskurs übergeführt, wenn z.B. „dem Markt“ Freiheit und „dem Nicht-Markt“ Unfreiheit zugeordnet werden. Auf diese Weise dient der Marktfundamentalismus bis heute wirkungsvoll der Verteidigung des bestehenden Wirtschaftssystems und der Diskreditierung aller noch so bescheidenen Alternativen.
- Der duale Code ist willkürlich errichtet, er steht in Diskrepanz zu empirischen Realitäten. In der Denkweise „des Marktes“ wird eine Realität behauptet, die in der institutionellen Wirklichkeit nach herkömmlichen empirischen Kriterien nicht nachgewiesen werden kann (S. 44ff.). Was „den Markt“ in der Realität tatsächlich auszeichnet, kann nicht gesagt werden (z.B. S. 44). „Der Markt“ ist ein Mythos, der sich wissenschaftlich geriert, aber nichtwissenschaftlicher Natur ist.
- Die Setzung von „Markt“ und „Nicht-Markt“ beinhaltet die Annahme von Kräften, die sich bekämpfen: „der Markt“ im Kampf mit dem „Nicht-Markt“ (S. 36). Dieser fiktive Antagonismus enthält in sich das Potenzial, die Denkweise „des Marktes“ in ihrem historischen Ablauf immer radikaler werden zu lassen. Je mehr Macht z.B. Politiker:innen, die an „den Markt“ glauben, besitzen, desto mehr werden sie die soziale Wirklichkeit anhand der Vorlage „des Marktes“ verändern, indem sie z.B. den Arbeitsmarkt oder das Finanzsystem „deregulieren“. Treten erkennbare Misserfolge (wie hohe Arbeitslosigkeit oder eine Finanzkrise) auf, dann werden sie mit der Forderung nach noch mehr „Markt“ beantwortet – die Spirale der Radikalisierung dreht sich weiter (S. 517ff.)
- „Der Markt“ enthält in dieser Weise ein utopisches Potenzial (S. 41ff.), das nach immer mehr „Markt“ drängt. Marktliberale heute sind radikaler als vor Jahrzehnten. Aktuelle Beispiele finden sich (1) bei Donald Trump, der im „Projekt 2025“ den US-Staat grundlegend verändern will, (2) im Versuch von Javier Milei das Parteiensystem in Argentinien zu zerstören, (3) in der Kritik aller staatlichen Institutionen durch Libertäre, (4) in den Behauptungen von Silicon-Milliardären wie Peter Theil, Demokratie und Freiheit seien prinzipiell nicht vereinbar oder (5) in den Bestrebungen reicher Personen, welt- weit tausende „ökonomische Sonderzonen“ zu errichten, in denen in einer gelebten Utopie „des Marktes“ tradierte Befugnisse des Staates durch Unternehmen ausgeübt werden. Alle genannten Projekte und Personen berufen sich auf „den Markt“ und stellen ihm einen „Nicht-Markt“ gegenüber.
- Die Tendenz zu einer Selbstradikalisierung geht Hand in Hand mit einer Abwertung herkömmlicher Wissensquellen (S. 444ff.). Sie betrifft auch das Wissen, das von Wissenschaften produziert wird. Im Denken „des Marktes“ ist die Tendenz angelegt, alle Sozialwissenschaftler:innen, welche strukturelle Probleme des Kapitalismus kritisch erkunden wollen, zu diskreditieren und sie vom Diskurs auszuschließen. Eine Steigerung stellt die Kritik am naturwissenschaftlichen Wissen dar. Das folgenreichste Beispiel sind die Erkenntnisse von Umweltexpert:innen zu den Krisen der Um- oder Mitwelt. Angesichts „des Marktes“ müssen sie verschwiegen und delegitimiert werden. Dazu wurde auch von Marktgläubigen seit Jahrzehnten ein Programm zur Erzeugung von Falschinformationen betrieben (S. 496ff.). Es hat mit beigetragen, die früher außer Streit gestellte Faktenbasis der Gesellschaft teilweise zu zerstören – ein wirkungsvoller Schritt, um sie dem Chaos „des Marktes“ bzw. seiner „spontanen Ordnung“ zu überlassen.
- Das Projekt einer Zerstörung der Faktenbasis der Gesellschaft und damit der Gesellschaft selbst wird heute vor allem von Rechtsradikalen betrieben. Vordergründig wenden sie sich gegen die Auswirkungen „der Globalisierung“ und gegen die Eliten „des Marktes“. Tatsächlich gehen sie aber in der Regel eine Synthese mit dem Denken „des Marktes“ ein, z.B. wenn sie ein Projekt eines „ökonomischen Nationalismus“ oder eines „exkludierenden Staates“ betreiben. Dabei werden die Grundstrukturen der neoliberalen globalen Ordnung (z.B. des Finanzsystems mit seinen Steueroasen) nicht thematisiert und nicht angetastet. Fast alle Programme von rechtsradikalen Richtungen enthalten direkt Verweise auf „den Markt“ (S. 539ff.).
- Zugleich werden im politischen Prozess demokratische Standards abgebaut. „Der Markt“, der als Hort der Freiheit und als „wahre Demokratie“ gilt, steht mit der Macht politisch souveräner Personen in Konkurrenz (S. 45, 127ff.). In der Verfestigung und Radikalisierung des Marktdenkens kann es sich an eine „illiberale Demokratie“ bzw. einen autoritären Staat anpassen. Ihre mythischen Grundlagen (z.B. die Geschichtsmythen einer Nation oder „des Volkes“) mischen sich mit dem Mythos „des Marktes“. Im Namen „des Marktes“ kann heute die liberale Demokratie zerstört werden.
- Dieser Prozess verhindert eine Lösung für die zahlreichen Probleme der Umwelt: wie das Artensterben, die Überfischung der Meere, die Übersäuerung der Böden, der zunehmende Plastik, der die Meere verseucht und den wir mit jedem Atemzug einatmen, oder die Erhitzung der Erde mit der Folge zunehmender Brände und Überflutungen. Die Totalität „des Marktes“ macht vor keine Grenze der Ökologie halt (S. 509ff.). Die Krisen der Umwelt können nur überwunden werden, wenn es kollektiv gelingt, die Denkfigur „des Marktes“ als lebensbedrohenden Mythos zu verstehen und global in seiner Wirkung zu beenden.