Abschiedsvorlesung an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung Koblenz, 26.9.2025
Vielen Dank für diese Veranstaltung und danke, dass ich vor Ihnen reden darf.
Ich habe mich entschlossen, über meine intellektuelle Entwicklung als Wissenschaftler an dieser Hochschule zu reden, ich war 10 Jahre bei Euch. Die Hochschule wurde am 1.10.2015 exakt an dem Tag eröffnet, an dem ich in Österreich in Rente gegangen bin. In meiner Welt wurde sie für mich geschaffen. Es waren zehn gute Jahre, dafür bin ich dankbar.
Persönlich zu sprechen heißt über sich selbst Geschichten zu erzählen. Als sinnstiftende Wesen erinnern wir uns an unsere Vergangenheit in Form von Geschichten und geben sie in Form von Geschichten weiter. Geschichten enthalten immer auch erfundene Teile, jeder persönlichen Geschichte kommt ein begrenzter Wahrheitswert zu.

Ich beginne mit einer dieser erinnerten bzw. halb erfundenen Geschichte. Am Montag, den 10. September 2012, also vor 18 Jahren, war ich an der Universität Göttingen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Helge Peukert hatte mit dem damaligen Arbeitskreis Real World Economics eine Erste Pluralistische Ergänzungsveranstaltung abgehalten. Sie fand parallel zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik statt - als Protest, dass dort keine Vertreter:innen einer pluralistischen Ökonomie sprechen durften. Neben mir saß eine junge, mir unbekannte Kollegin. Nach meinem kurzen Vortrag sprach sie zum Thema Wider die geistige Monokultur in der Wirtschaft – Ökonomie neu denken lernen. Danach blickten wir uns in die Augen, und zumindest ich hatte den Gedanke: Da sitzt neben mir eine Person, die so denkt wie ich. Diese Person war – Sie haben es erraten – Silja Graupe. Ich hatte eine kluge Mitstreiterin kennengelernt, die mein Leben ungemein bereichern sollte.
Damals leitete ich an der Johannes Kepler Universität Linz ein Institut, das ich im Jahre 2009 mit Hilfe der Stadt Linz gründen durfte und das die Erforschung der Ursachen der Finanzkrise 2008 zum Inhalt hatte. Mein Denkframe für die beabsichtigte Forschung im Institut war die Geschichte des Neoliberalismus, wie sie vor gut 20 Jahren bekannt war - nämlich als Geschichte von Think-Tanks, denen es gelungen war, die Öffentlichkeit und die Politik manipulativ zu beeinflussen. In dem neuen Institut hatte ich als zweiten Mitarbeiter eine Person aus dem kleinen Netzwerk der diesbezüglichen deutschsprachigen Think-Tank-Forscher eingestellt.
Deren Geschichte des Neoliberalismus war nicht falsch, aber unvollständig. Ihr Widerhall waren später Seminare an der zu gründenden Hochschule in Bernkastel-Kues (ich erinnere mich lebhaft an ein Seminar in der Alten Synagoge mit Silja), bei der wir den Gedanken des bildhaften Denkens mit Imaginationsübungen und -techniken im Frame von Manipulation vermitteln versuchten – die Studierenden lehnten das zu Recht ab, manche waren entsetzt. Heute ist das in anderen Frames und auch theoretisch im Unterricht integriert, aber das mussten wir erst lernen.
Später wurde die Vorstellung von der Geschichte des Neoliberalismus, die wir im Linzer Institut anfangs vertraten, durch mehrere Projekte verändert, in den wir die Beziehung von Denkformen zu Öffentlichkeit und Politik und ihre Wechselwirkungen genauer studierten. Wir konnten auch die Erkenntnisse von Ludwick Fleck und Bruno Latour in unser Bild integrieren. Ein Ergebnis war dann das Buch Netzwerke des Marktes. Ordoliberalismus als Politische Ökonomie, das wir erst 2017 publizierten. Darin wurde eine Skizze zu einer Geschichte des deutschen Ordoliberalismus (den wir als Sonderform des Neoliberalismus bzw. des Marktfundamentalismus interpretierten) entworfen, z.B. zur Frage, wie es ihm nach 1945 gelungen ist, ihr Konzept der Wirtschaftspolitik politisch durchzusetzen - bis hin zur Gründung der AfD im Jahre 2013. Sie wurde ja anfangs als Professorenpartei tituliert, es ging ums ordoliberale Professoren.
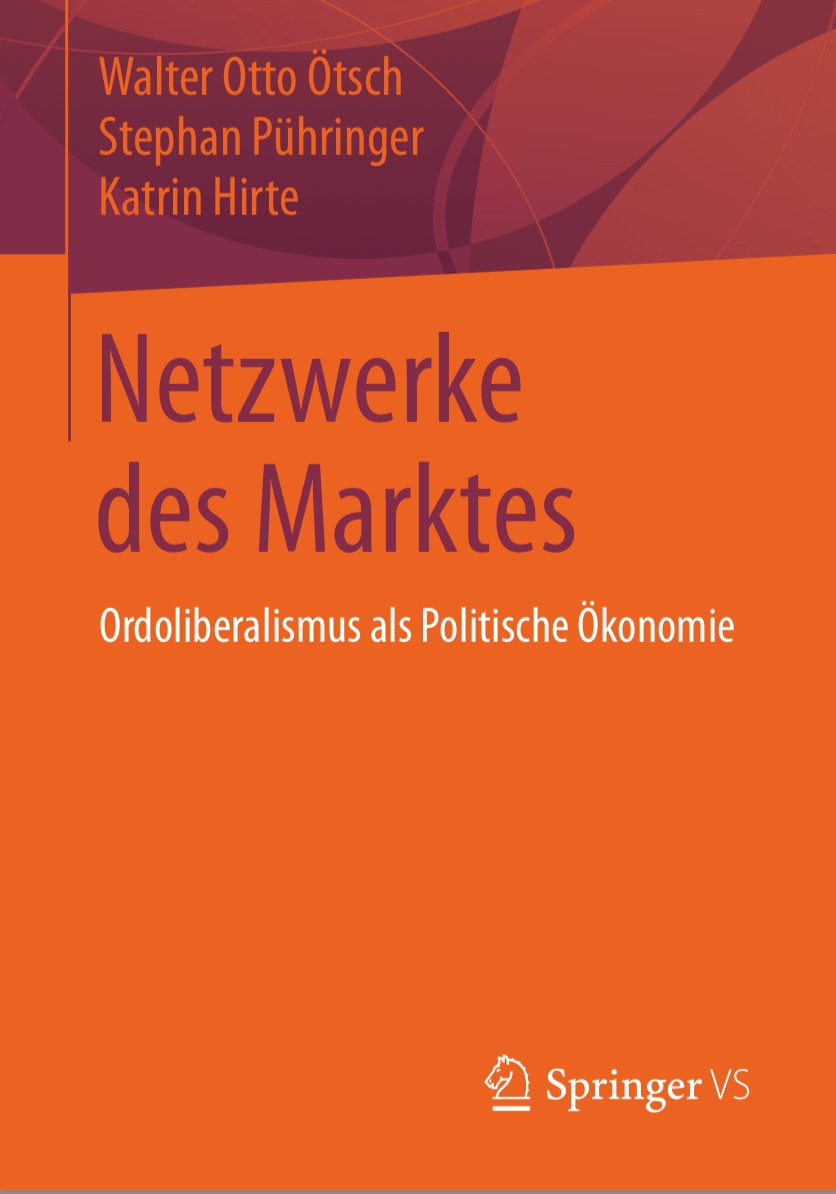
Eine Frage, die uns am Institut in Linz jahrelang beschäftigte, war: Welche Theorie der Gesellschaft benötigen wir, um den Neoliberalismus in seinen gesellschaftsverändernden Aspekten verstehen zu können? Sollen wir die Gesellschaft als Ansammlung abstrakter Strukturen und ihrer Beziehungen oder als Ensemble lebendiger Praktiken und Prozesse verstehen, wie wir sie in auch in anderen Projekten am Institut kennenlernt hatten – z.B. zu der Art, wie Ökonom:innen sich nach 2008 medial zur Finanzkrise geäußert und mit welche Metaphern sie die Krise vermittelt hatten. Löst sich Gesellschaft in eine Vielzahl von Praktiken auf und sind „Individuen“ tatsächlich die behaupteten fixen Subjekte (wie das z.B. die neoklassische Theorie annimmt) oder vielmehr eher sich in Praktiken konstituierende Wesen? Und warum hat die Soziologie aufgehört, über die Gesellschaft insgesamt nachzudenken und formuliert keine zeitgemäße Theorie der Gesellschaft mehr? Was bedeutet es in dieser Situation, derart theorielos von Kapitalismus zu reden?
Sehr viel später wurde mir bewusst, wie schief diese Fragen selbst angelegt waren und dass sie beantwortet werden können. Sie betreffen auch – wenn ich das sagen darf – das Selbstverständnis dessen, was an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung im kritischen Denken vermittelt wird. Ich versuche diesen Fragenkomplex kurz mit dem Verweis auf Karl Marx zu erörtern. Marx hatte seinem Hauptwerk den Untertitel Kritik der politischen Ökonomie gegeben. Dieser Hinweis wird herkömmlich so verstanden: Marx hatte die Theorien der politischen Ökonomien seiner Zeit studiert und eine detaillierte hochtheoretische Kritik an ihnen formuliert. Kritik der politischen Ökonomie benennt demnach seine eigene Kritik an der damals herrschenden Ökonomie. Indem wir hier an der Hochschule fundamental und tiefgehend die neoklassische Mainstream-Ökonomie, neoliberale Wirtschaftstheorien und andere Theorien, wie die behavioral economics, kritisieren, praktizieren wir das, was Marx für seine Zeit leistete: eine Kritik einflussreicher ökonomischer Theorien der jeweiligen Zeit.
Aber Kritik der politischen Ökonomie hatte für Marx noch eine zweite Bedeutung. Es handelt sich nicht um die politische Ökonomie der damaligen Zeit, sondern um die politische Ökonomie, die Marx selbst entwickelt hat: seine eigene politische Ökonomie. Diese Theorie bzw. diese Theorien beschreiben, wie der Kapitalismus zu seiner Zeit funktioniert hat: eine sozioökonomischen Formbestimmung der damaligen Selbst-, Sozial- und Weltverhältnisse – eine Ordnung der Gesellschaft, der Dinge und des Selbst.
Marxs Beschreibungen sind gesellschaftskritischer Art und zielen auf eine Transformation der Gesellschaft – unabhängig davon, wie wir heute seine Theorien und seine Zukunftsbilder bewerten. Marxs Theorien standen der herrschenden Gesellschaft seiner Zeit kritisch gegenüber und versuchten eine Perspektive zu vermitteln, dass Wirtschaften auch ganz anders möglich sein könnte. Kritik der politischen Ökonomie heißt demnach für Marx auch: Jene Kritik, zu der er auf Basis seiner eigenen politischen Ökonomie in der Lage war. Diese Kritik war, wie wir wissen, historisch ungemein folgenreich.
Zumindest implizit wird dieser zweite Aspekt einer genuin politischen Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in vielen Facetten vorangetrieben. Wir unterrichten kritischen Aspekte der heutigen Gesellschaft und des heutigen Wirtschaftssystems und versuchen die Studierenden in dieser Kritik theoretisch und praktisch zu schulen, Lösungen anzuzeigen und dafür notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. Die Absicht Gesellschaft zu gestalten basiert auf einer Kritik der Gesellschaft bzw. von wesentlichen Aspekten der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft. Wenn wir – wie das im Unterricht von Anfang an gemacht wird – von einer ökonomisierten Gesellschaft oder von Neoliberalismus als einem Projekt zur Veränderung der Gesellschaft sprechen, dann versuchen wir einen analytisch-kritischen Blick auf die Gesellschaft, auch in ihrer historischen Genese, zu vermitteln und zugleich Konturen von Aspekten eines anderen Wirtschaftens zugänglich zu machen.
Pointiert und übertrieben könnte man sagen: Angesichts des Unterfangens, das diese Hochschule unternimmt, brauchen wir nicht nach einer adäquaten Theorie der heutigen Gesellschaft suchen. Die Frage nach einer neuen Theorie der Gesellschaft ist eine Scheinfrage, weil wir sowohl eine Vorstellung einer ökonomisierten Gesellschaft in vielen Aspekten bereits entwickelt haben, als auch genau sagen können, was in jedem dieser Aspekte anders ablaufen könnte und sollte. Hinter dem, was wir an dieser Hochschule forschen und lehren, schimmern die Konturen einer Theorie der Gesellschaft durch. Wir brauchen nicht andere nach einer Theorie der Gesellschaft zu befragen, weil wir sie selbst schon entwickeln bzw. schon entwickelt haben.
Die Aussage nach dem impliziten Vorhandensein einer Theorie der aktuellen Gesellschaft muss von der Qualität, der Reichweite und der Vollständigkeit einer solchen Theorie getrennt werden, d.h. von der Frage, wie explizit eine solche Theorie bereits vorhanden ist und wie umfangreich sie zu sein hat. Dazu möchte ich später etwas sagen.
Die Klarheit vom Wandel von einer Kritik von Theorien zu positiven Aussagen über eine neue Theorie kam für mich im November 2016, nachdem Donald Trump zum erstmal zum Präsidenten der USA gewählt worden war. Ich hatte mich, wie Sie ja wissen, seit vielen Jahren mit den extremen Rechten auseinandergesetzt und sogar im Mai 2016 gewettet, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Nach der Wahl wurde mir klar, dass wir in unseren internen Überlegungen auch zum Konzept der Hochschule eine neue Ebene betreten müssten – andere an dieser Hochschule wussten das vermutlich schon früher.
Dazu wieder eine halb erfundene Geschichte. Damals sagte ich zu Silja: Wir müssen aufhören uns nur als Kritiker:innen der dominanten Theorien der Ökonomie zu verstehen, sondern wir müssen die Wissenschaft selbst in ihrem Kern verteidigen. Das gilt auch und gerade für die Wirtschaftswissenschaften. Wir als Kritikerinnen der herrschenden ökonomischen Lehren müssen das Feld der Wirtschaftswissenschaften in seiner Wissenschaftlichkeit verteidigen, selbst wenn die Vertreterinnen der Mainstream-Ökonomie dazu nicht in der Lage sind. Denn das wissenschaftliche Denken insgesamt steht in Gefahr und wie umfangreich heute die Wissenschaften, vor allem die kritischen Sozialwissenschaften, gefährdet sind, wird nicht nur in den USA vorexerziert. Wir betreten spätestens in diesem Jahr eine neue Ära der Wissenschaftsfeindlichkeit, die nicht nur ökologische Themen, sondern den gesamten Bereich der Sozialwissenschaften inklusive der Ökonomie tangiert.
Der Umschwung von einer Kritik der Ökonomie zur Formulierung von Elementen einer neuen positiven Ökonomie ist an der Hochschule vollzogen, alle hier Wirkenden sind daran beteiligt. Er manifestiert sich im Umschwung von einer Kritik einer fehlenden Gestaltung der Gesellschaft zu einer positiven Vorstellung ihrer Gestaltung und der Vermittlung dazu notwendiger Kenntnisse und Fähigkeiten. In dem Teilbereich, den ich vorher angesprochen habe, wurde der manipulative Frame für die Erklärung simulativer Bilder nicht zur Gänze aufgegeben (gesellschaftlich findet ungemein viel Manipulation statt), sondern der Fokus im Unterricht auf die Anwendung mentaler Bilder für die eigene Selbststeuerung und später auf das Verständnis, Finden und Kreieren utopischer Elemente der gesellschaftlichen Wirklichkeit gelenkt. Die Relevanz mentaler Bilder zum Verständnis der Ökonomie (die zu betonen mir immer wichtig war) wurde u.a. in einem eigenen Lehrgang versucht und ist heute in mehrere Module im Unterricht integriert.
In diesem Prozess wurde mir immer mehr bewusst, was Hayek mit seinen Konzepten zum Neoliberalismus angerichtet hat. Er hat den Menschen generell (nicht nur den Politiker:innen) die Fähigkeit abgesprochen in Bezug auf Wirtschaft und Gesellschaft aktiv und kreativ mental gestaltend tätig zu sein. Die Menschen seien, so meint er, unbewusst und ohne Möglichkeit darüber zu reflektieren, an die Preissignale ‚des Marktes‘ gebunden. Zugleich nimmt er (in einer geheimen, nur für den inneren Zirkel bestimmten Anwendung) für sich in Anspruch, Bilder der Gesellschaft zu entwerfen, das sei, so sagt er Ende der 1940er-Jahre, eine Leistung, zu der nur die Genies der Wissenschaft, die original thinkers, in der Lage seien.
Die Analyse von Hayeks Konzept ‚des Marktes’ lässt mich heute die Frage nach einer Theorie der Gesellschaft so darstellen: ‚Der Markt‘ bezeichnet kein gesondertes Phänomen der Wirtschaft und nicht der Wirtschaft als Teilsystem –weder als Subsystem der Gesellschaft noch der Biosphäre. Denn ‚der Markt‘ kann inhaltlich nicht definiert oder institutionell operationalisiert werden. Er kann überhaupt nicht verifiziert oder falsifiziert werden. Er beschreibt ein Erklärungsprinzip zur Ordnung wirtschaftlicher Phänomene. Eine Erklärungsprinzip dient der Erklärung von Phänomenen, aber kann durch Phänomene nicht begründet oder widerlegt werden. ‚Der Markt’ ist ein angenommener Prinzipienbegriff – schlichtweg ein Glaubenssystem.
Im Anschluss an Kant stehen hinter Prinzipien dieser Art regulative Ideen – diese sind nach Kant unverzichtbare Leitfunktionen für jede wissenschaftliche Praxis. Beispiele sind für ihn Gott, Seele und Welt oder die Einheit des Erfahrungssubjekts und des Erfahrungsobjekts. Diese Begriffe beschreiben einen Horizont: eine Erfahrungstotalität, die selbst nicht Gegenstand der Erfahrung sein kann. Regulative Ideen fungieren, wie Kant schreibt, wie Fluchtpunkte in einem Bild. Sie ordnen alles zu einer erfahrbaren, eben sinnvollen Einheit.
‚Der Markt‘ kann nach Kant auch als regulative Idee verstanden werden. Er beschreibt nichts in der Wirtschaft, sondern wie in der Wirtschaft denen, die ‚ihn‘ für wahr halten, Sinn gegeben werden kann. Ein Manager kann der Aussage, seine Firma müsse sich am Markt behaupten, Sinn geben, weil sie auf abstrakte Weise das beschreibt, was er tut. Auch ihr, liebe Absolvent:innen könntet der Meinung sein (ich weiß, Ihr denkt nicht so), ‚der Markt‘ habe Eure Ausbildung belohnt – oder eben nicht. Im letzteren Fall hat „er“ Euch bestraft.
Wie total dieses Denken die Vorstellungswelt breiter Teile der Öffentlichkeit durchdrungen hat, soll an dem besorgniserregenden Satz illustriert werden: Wir können eher ein Ende der Welt denken als ein Ende des Kapitalismus. Das Besondere ist nicht, dass diese Aussage in hohem Maße wahr ist, sie trifft für viele zu, sondern, dass wir die Aussage selbst verstehen. Wir verstehen es, dass auf diese Weise gedacht werden kann. Demgegenüber würden uns folgende Aussagen absurd vorkommen: Wir können eher ein Ende der Welt denken, als ein Ende der Theokratie (wie im Iran), oder: der monarchistischen Diktatur (wie in Saudi-Arabien), oder: der feudalen Leibeigenschaft (wie im europäischen Mittelalter) oder: der Einehe, usw. Das Nicht-denken-können eines möglichen Endes der kapitalistischen Vergesellschaftungsform zeigt, wie sie zum sinnstiftenden Horizont geworden ist, über den hinauszudenken für viele unvorstellbar geworden ist.
Der Kapitalismus, der zum ‚Markt‘ geworden ist, strukturiert nämlich Wirklichkeitserfahrungen. ‚Der Markt‘ als regulative Idee macht verständlich, dass in diesem Denkregime die Umweltkrise in seinem fatalen Ausmass schlichtweg nicht erkannt werden kann – das kann an vielen konservativen Politiker:innen studiert werden. Ein Prinzipienbegriff schafft eine eigene Art der sozialen Wahrnehmung, einen Horizont der Erfahrung, der nur als geglaubtes Prinzip wirken kann, aber nicht wirklich im eigentlichen Sinn ist. Als Prinzip bzw. als regulative Idee liegt er jenseits jeder Erfahrung. Egal welche ökologischen Desaster der geglaubt wirkende ‚Markt’ hervorruft und noch hervorrufen wird, die Lösung kann in diesem Denkgefängnis immer nur ‚mehr Markt‘ sein. Die Krankheit und die Medizin sind identisch in einem totalitären Bild aufgehoben. Hayek hat seine Ordnung ‚des Marktes‘ zu Recht als „transzendent“ bezeichnet.
‚Der Markt‘ ist die neoliberale Antwort darauf, wie soziale Ordnung überhaupt möglich ist, nämlich nur durch ihn. Als regulative Idee entspricht er der Vorstellung Gottes, der Idee einer Vollkommenheit und einer letzten Ursache. Kant braucht Gott als regulative Idee für seine Theorien. Er benötigt aber nicht die Annahme, dass Gott existiert. Er definiert ihn im Modus des „Als ob“ – „als ob es Gott gäbe“. Kants Basis und Ausgangspunkt ist immer der Mensch mit seinem Vorstellungsvermögen. Hayek hingegen setzt ‚den Markt‘ stillschweigend als regulative Idee und schreibt ihm zugleich eine reale Existenz zu. Im Gegensatz zu Kant entzieht sich sein Begriff von ‚dem Markt‘ einer menschlichen Reflexion, er wird als ein „Überbewusstes“ der menschlichen Vernunft entzogen. Seine Vorstellung ist heute gesellschaftswirksam geworden. ‚Der Markt’ ist der gesellschaftliche Gott in einer gottlosen Zeit.
Hayek will mit seiner Begriffsbildung die Errungenschaften der Aufklärung aufheben. Er entwickelt dazu eine kuriose Ideengeschichte der Moderne, in der er Hegel, Kant und Marx niemals ernsthaft diskutiert - er hat sie, blank jeder philosophischen Schulung, schlichtweg nicht verstanden. Hayeks „wahrer Liberalismus“ ist gegen die Aufklärung gerichtet und will deren Errungenschaften beseitigen.
Aber Hayek geht in der Ideengeschichte Europas noch viel weiter zurück. Er stellt auch das moralische Vermögen von Menschen in Frage und geht historisch damit hinter den Gewissensbegriff von Sokrates und die darauf aufbauende Vorstellung eines personalen und später individuellen Gewissens im Christentum zurück. Implizit etabliert er damit im Bereich der Gesellschaft ein vorsokratisches, un- oder vorkritisches und damit vorwissenschaftliches Denken. Es enthält Elemente einer mythischen Denkform, wie sie im Schlagwort von der historischen Entwicklung vom „Mythos zum Logos“ zum Ausdruck kommt.
Sein Begriff von Markt ist Ausdruck eines mythischen Denkens, wie es zum Beispiel Ernst Cassirer als symbolische Denk- und Wahrnehmungsform untersucht hat. In dieser Deutung, die ich im letzten Jahr mit Patrick Makal von der Universität Paderborn entwickelt habe (wir wollen darüber ein Buch schreiben) vollzieht sich die ökonomisierte Gesellschaft unter dem Horizont ‚des Marktes‘, in welchem nicht nur die Aufklärung als belanglos abgetan wird, sondern auch Rekurs auf genuin mythische Vorstellungen genommen wird. Das rationale wissenschaftliche Denken wird nicht abgeschafft, bleibt aber auf die Mikroebene der Gesellschaft beschränkt - so kann sich die neoklassische Mikroökonomie in den Marktfundamentalismus einfügen – die Vorstellung vom sozialen Ganzen hingegen verschwimmt in einem mythischen Nebel.
Dieses Konzept hat bedeutsame Auswirkungen, die aktuell zu beobachten sind. ‚Der Markt’ als Mythos im Sinn einer symbolischen Form schafft auch einen Raum, in dem das Konzept ‚des Marktes‘ mit rechtsextremen mythischen Vorstellungen von Volk, Rasse, Kultur oder weißer Männlichkeit eine Synthese eingehen kann. Sie gipfelt historisch in der zweiten Regierung von Trump, das Drehbuch dazu hat der neoliberale Think-Tank Heritage Foundation gemeinsam mit der MAGA-Bewegung geschrieben. Trumps Regierung ist eine widersprüchliche Koalition mehrerer marktfundamentaler und rechtsradikaler Richtungen. Darin entsteht, wie Quinn Slobodian in seinem neuesten Buch Hayek’s Bastards anhand der handelnden Personen im Detail gezeigt hat, eine neue Form eines autoritären, nationalen und rassistischen Kapitalismus. Sie stellt kein Ende des Neoliberalismus dar, wie viele argumentieren, sondern seine neueste radikalisierte Variante, die in den Theorien von Hayek bereits angelegt war.
Dabei synthetisiert der Mythos ‚des homogenen Marktes‘ mit dem Mythos ‚des homogenen Volkes‘ – und wie zur Bestätigung lässt Trump in seiner Willkürherrschaft Formen einer archaischen Wirtschaft wiederaufleben, wie sie historisch in den Jahrhunderten vor der griechischen Achsenzeit bekannt sind. Wie uns Birger Priddat bei der Tagung vor 14 Tagen (die ich mit Patrick Makal und mit Oliver Schlaudt organisiert habe) erklärt hat, handelt es sich um Bestandteile einer Beute- und Gabenökonomie, dazu werden korrupte Clan-Strukturen etabliert. An den Clanchef Trump müssen vom In- und Ausland Huldgaben errichtet werden – vom Flugzeug bis zum Einkauf in seine Krypto-Währung. Wer zahlt, bekommt Privilegien, z.B. Zollnachlass oder Zollaufhebung, Staatsaufträge oder Schutz für globale IT-Monopole. Diplomatie wird durch deal-making ersetzt. Ein guter deal ist, wenn andere sich unterworfen haben. Der Gewinn aus den deals hat den Rang einer Beute. Trumps narzisstischer Charakter beleuchtet die gesellschaftliche Charakterdisposition der aktuellen marktfundamentalen Vergesellschaftung.
Die Regierungsform, die so etabliert wird, ist zutiefst instabil: morgen kann der selbsternannte König seine Gnadenbeweise an andere Günstlinge verteilen – und wir wissen nicht, welche politischen und wirtschaftlichen Krisen damit künftig ausgelöst werden. Ob diese neue Form von Politik in ihren menschenverachtenden, grausamen und demokratiegefährdenden Aspekten auch in Europa Einzug halten wird, ist offen. Der Widerstand gegen die AfD in Deutschland ist groß und die HfGG arbeitet mit allen ihren Programmen gegen eine solche Zukunft. Wir sind Teil einer lebendigen Widerstandskultur – mit einem theoretischen und praktischen Blick auf positive Alternativen. Ich wünsche dieser Hochschule ein langes Leben.
Ich bedanke mich bei allen für zehn schöne Jahre. Ich bedanke mich bei meinen Kolleg:innen für viele intensive und lehrreiche Diskussionen. Ich bedanke mich bei Silja für das viele, das wir gemeinsam machen konnten. Ganz besonders bedanke ich mich auch bei den Studierenden. Die Intensität der Begegnung mit ihnen, die Auseinandersetzungen und der Zuspruch waren enorm, manchmal war es fast zu viel. Der Unterricht mit und für Euch wird mir abgehen.
Und in 10 Jahren feiern wir wieder!